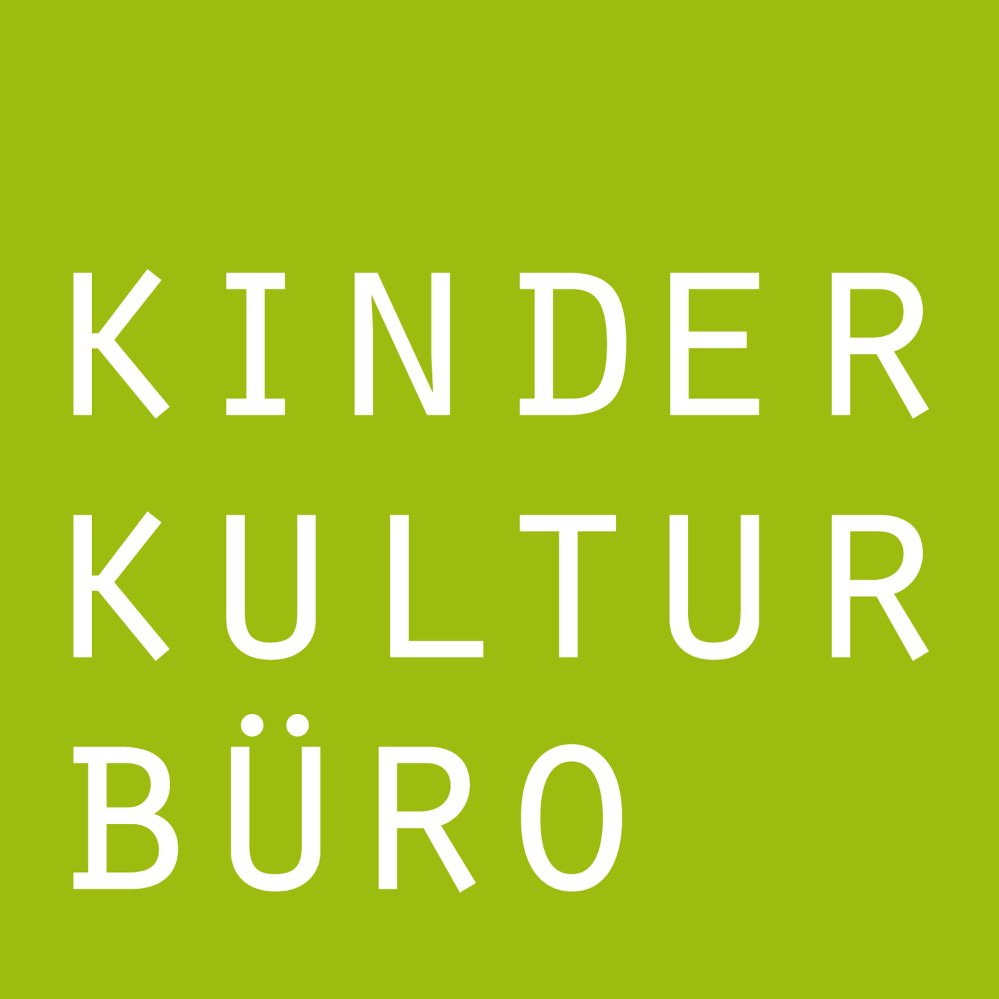Die Elbe ist ein mitteleuropäischer Fluss der in Tschechien entspringt, durch Deutschland fließt und in die Nordsee mündet. Sie besitzt eine Gesamtlänge von 1.094 Kilometern und ist damit der vierzehntlängste Fluss in Europa. Die Elbe gehört zu den 200 größten Flüssen der Welt. In Hamburg teilt sich die Elbe in Norder- und Süderelbe auf. Generell gibt es eine Ober- und eine Unterelbe. Die Unterelbe beginnt bei Geesthacht, der Lauf der Elbe wird nun von den Gezeiten beeinflusst. Von Hamburg bis zur Mündung in die Nordsee bei Cuxhaven wird die Elbe immer breiter – von 2,5 auf ca. 15 Kilometer.
Fischarten der Elbe
Gegenwärtig setzt sich die Fischfauna des Elbestroms aus 112 Arten zusammen. Dazu zählen 47 limnische (im Süßwasser lebende), 17 euryhaline (Wanderarten zwischen Salz- und Süßwasser) sowie 48 marine Arten (Salzwasserfische). Dazu zählten Standfische ebenso wie Wanderfische, die zwischen dem Flusssystem und dem offenen Meer hin- und herwechselten. Neben dem Aal ist der Lachs der bedeutendste Vertreter der Wanderfischarten in der Elbe. Die meisten Fischarten leben in der Tide-Elbe im Raum Hamburg: Im Brackwasser Bereich fühlen sich sowohl Salzwasser- als auch Süßwasser-Fischarten wohl.
-
Die Elbe galt einst als einer der fischreichsten Flüsse Europas. Noch um 1900 lagen die Erträge der Elbfischer mit rund 100 Kilogramm pro Hektar doppelt so hoch wie in Seen. Dazu zählten Standfische ebenso wie Wanderfische, die zwischen dem Flusssystem und dem offenen Meer hin- und herwechselten. Zu den spektakulärsten Wanderfischarten gehörte der Stör, von dem manchmal über drei Meter lange Exemplare gefangen wurden.
Vor 1918 wurden noch rd. 9.840 t Fisch in der Unterelbe gefangen und mit 1.200 Booten hauptberuflich dem Fischfang nachgegangen. Heutzutage sind es nur noch wenige, die den Fischfang in der Elbe betreiben
Bereits im 19 Jahrhundert gingen die Bestände dann zurück – verursacht durch erste Ausbaumaßnahmen im Fluss, Uferbefestigungen und Beseitigung von Kiesbänken.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen industrielle Abwässer hinzu, die den Sauerstoffgehalt des Flusswassers reduzierten und dieses vergifteten. 1921 wurde in Brandenburg vermutlich der letzte kapitale Elb-Stör gefangen.
1960 wurde in Geeshacht eine Staustufe gebaut, damit endete die freie Wandermöglichkeit zwischen Fluss und Nordsee; ein vorhandener Fischpass war praktisch unwirksam.
Außerdem trug die extreme Wasserverschmutzung im 20. Jahrhundert ein Übriges zum Aussterben vieler Fischarten bei.
Seit der deutlichen Verbesserung der Wasserqualität um 1990 erholen sich einige Fischbestände, und die Artenvielfalt stieg wieder an. Es wurde erkannt, wie wichtig die Durchgängigkeit der Staustufen ist. Ein erst 1998 errichtetes Umgehungsgerinne an der Staustufe Geesthacht konnte die Durchgängigkeit dennoch nur für kräftige Fischarten beschränkter Größe verbessern.
Erst seit August 2010 ist mit einer weiteren flacheren und größeren Fischaufstiegsanlage die als Ausgleichsmaßnahme für das Kohlekraftwerk Moorburg errichtet wurde, die Staustufe wieder weitgehend durchgängig, auch für schwache Arten wie Stinte und für den sehr großen atlantischen Stör.
Auch heute noch sind einige Fische der Elbe aufgrund der Verschmutzung des Wassers nicht genießbar. Gerade ältere Fische, die am Flußboden leben sind durch Schwermetalle stark belastet. -
Die Elbvertiefung beschäftigt Hamburg schon lange. Seit 20 Jahren wird darüber verhandelt. Der Hamburg Hafen braucht eine Vertiefung um größere Containerschiffe passieren lassen zu können. Dies ist für die Wirtschaft ein großer Nutzen, aber für die Natur ein großer Einschnitt. Naturschutzorganisationen haben versucht dies Unterfangen juristisch zu stoppen, aber erfolglos. Am 24. Januar 2021 ist es nun vollständig beschlossen: die Elbe wird tiefer gebaggert. In Zukunft sollen zwischen Cuxhaven und Hamburg-Altenwerder auf einer Strecke von 130 Kilometern Saugrohre durch das Flussbett schieben und rund 38,5 Millionen Kubikmeter Sediment vom Grund der Elbe absaugen und heraufbefördern. Schon jetzt wurde regelmäßig die Elbe ausgebaggert um Schiffe zu empfangen. Dieses „Unterhaltungsbaggern“ sorgt dafür, dass der immer wieder ansammelnde Schlick entfernt wird um die notwendige Tiefe zu erhalten. Dieses Baggern hat bereits Schaden den Fischen zugefügt., denn es führt zu Sauerstoffmangel im Wasser, so dass viele Fische ersticken. Dazu tragen auch extrem hohe sowie extrem niedrige Wasserstandssituationen bei – im ersteren Fall werden dann beispielsweise viele Nährstoffe aus überschwemmten Ackerflächen in den Fluss eingetragen, die zu Algenblüten und anschließender Sauerstoffzehrung führen.
Durch das Absaugen und Heraufbefördern des Schlicks werden Krebstiere, Würmer, Schnecken oder etwa Muscheln dadurch mit weggesaugt.
Es ändert sich zudem das Fließverhalten der Elbe. Je tiefer ihr Bett, desto mehr Wasser wird bewegt Der Strom fließt schneller und verletzt durch seine Kraft Narben die Uferlandschaft. Die letzten Vertiefungen haben das bereits gezeigt: Vor allem an schmalen Stellen und Flusskurven zwischen Hamburg und Cuxhaven mussten ganze Uferzonen neu befestigt werden.
Wird die Elbe weiter ausgebaggert, verändern sich auch die Wasserstände. Lag der Tidehub vor 150 Jahren noch bei 1,40 Meter, beträgt er heute mehr als das Doppelte. Auch der Gezeitenstrom hinterlässt inzwischen immer deutlichere Spuren. Bei Flut drückt das Wasser schneller und stärker stromaufwärts, spült Sediment und Schlick aus der Nordsee in den Fluss und seine Nebenarme. Bei Ebbe dagegen fließt es langsamer und sinkt stärker, eingetragenes Material wird nicht mehr abtransportiert. Dadurch entsteht der Schlick, der auch in Zukunft regelmäßig entfernt werden muss. Flachwasserbereiche verschlicken und fallen trocken. Ganze Seitenarme verlanden. Doch gerade diese Wasserzonen in Ufernähe sind besonders sauerstoffreich, sonnendurchflutet und bergen Nahrung für alle möglichen Arten. Drückt zudem Meerwasser stärker in die Elbe, drohen Süßwasserbereiche zu versalzen. Die dort angepasste Tier- und Pflanzenwelt nimmt zwangsläufig Schaden.
Wandernde Fischarten wie Lachs, Schnäpel, Stör, Aal oder Finte sind auf die Tideelbe als Durchzugsstation in ihre Laichgebiete angewiesen. Eine weitere Vertiefung führt wegen zunehmender Unterhaltsbaggerungen und biologischer Abbauprozesse im tiefen, lichtfreien Wasser zu Sauerstoffarmut im Hafen. Diese „Sauerstofflöcher“ treten in den Sommermonaten auf und gefährden den Fischbestand, wie zum Beispiel im Juli 2014, als 100 Tonnen Fisch in der Elbe verendeten.
Während Flachwasserzonen trockenfallen, in denen vorher Algen Sauerstoff produziert haben, vergrößern sich die tiefen Flussbereiche. Dorthin dringt zu wenig Licht, Algen sterben ab und werden von Mikroorganismen abgebaut. Die Mikroben verbrauchen dabei Sauerstoff. Eine weitere Vertiefung würde den Bereich, in dem Sauerstoff produziert wird verkleinern und die Zone, in der Sauerstoff verbraucht wird, vergrößern. Die Folgen der vergangenen Vertiefungen zeigen sich heute schon in den jährlich über die Sommermonate auftretenden und für Fische tödlichen „Sauerstofflöchern“. Solche Todeszonen bilden für wandernde Fische wie Meerforelle, Lachs oder Flussneuenauge unüberwindbare Hindernisse auf ihrem Weg in die Laichgebiete. Die Wasserqualität wird sich stark verschlechtern. -
Der ursprüngliche Fischbestand, der bereits in der Industrialisierung durch starke Wasserverschmutzung zurückging und sich in den 1990er Jahren sich langsam wieder verbesserte ist nun so stark gefährdet wie nie. Lebendraum wird zerstört, Nahrung wird entzogen. Die Artenvielfalt wird zurückgehen. Es werden einige Fischarten abwandern, einige werden vielleicht sogar aussterben. Denn wandernde Fischarten wie Lachs, Schnäpel, Stör, Aal oder Finte sind auf die Tideelbe als Durchzugsstation in ihre Laichgebiete angewiesen.
Für die globale Wirtschaft mag die Elbvertiefung ein großer Gewinn sein – für unsere Fischarten mit Sicherheit nicht. -
Atlas der Fische: https://www.hamburg.de/contentblob/4457730/8b659b697a9587b7871664757c180087/data/download-fischgutachten-2015.pdf
Die Fischfauna der Elbe:
https://www.fgg-elbe.de/files/Download-Archive/Oeffentlichkeitsmaterialien/Poster_ARGE-Elbe/04FischPoster.pdf
Nabu Schleswig-Holstein:
https://schleswig-holstein.nabu.de/tiere-und-pflanzen/fische-und-neunaugen/03308.html
Elbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Elbe
WWF: Die Folgen der Vertiefung
https://www.wwf.de/themen-projekte/projektregionen/tideelbe/folgen-fuer-fluss-und-umwelt
Artikel im Hamburger Abendblatt zur Elbvertiefung (25.1.2022)